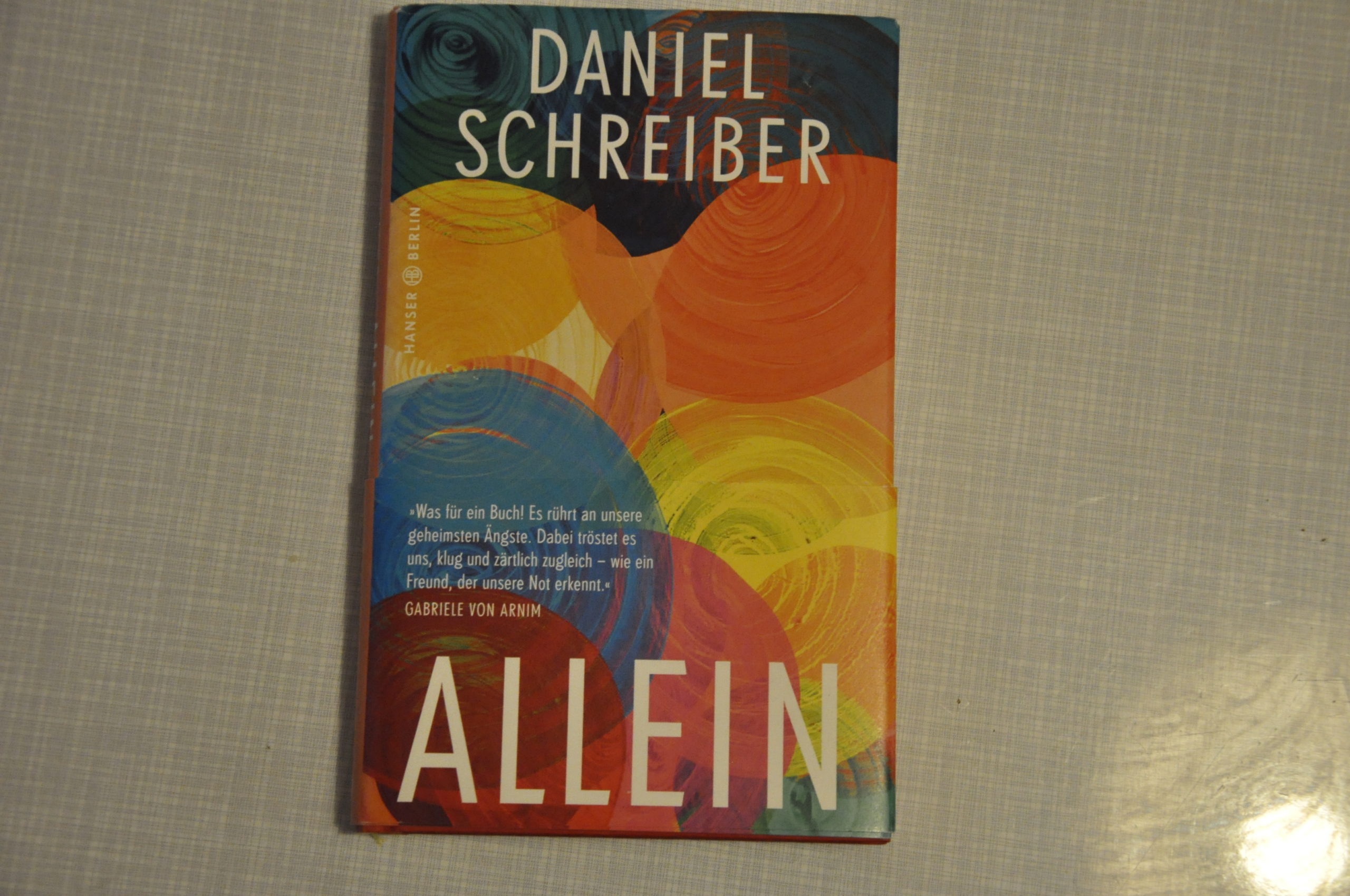
Von Daniel Schreiber ist vor kurzem ein neues Buch erschienen, es heißt „Zeit der Verluste“ und geht darüber, wie schwer es ist, zu trauern. Trauer überhaupt zuzulassen. Wir wissen ja überhaupt nicht, wie das gehen soll – zu trauern. Anlass oder der Rahmen dessen, was er im neuen Buch reflektiert, ist der Tod seines Vaters. Sein Vater war lang krank gewesen, er hatte während Corona gewollt, dass die Kinder ihn nur anrufen, nicht besuchen, dann bat er doch um einen letzten Besuch. Aber Schreiber war auf Lesereise, er schob den Besuch hinaus – bis die Mutter ihn anrief genau in dem Moment, in dem er in Heidelberg die Treppe zur Bühne raufging, um eine weitere Lesung zu bestreiten. Der Vater war gestorben. Dann schrieb er das Buch.
Ich habe von ihm zwei andere Bücher gelesen, „Zuhause“ und „Allein“. Vor allem „Allein“ war ein Riesenerfolg. Er schreibt darin, dass, wenn man alleine lebt und sich allein fühlt, während man allein lebt, Besuche, die man bekommt, die man bei anderen macht, überhaupt nicht helfen. Im Gegenteil: Je mehr man unterwegs ist, desto schwerer trifft einen die Tatsache, dass man allein ist, sobald man daheim die Tür aufsperrt. Oder halt in dem Moment, in dem Besuch, den man hatte, wieder geht.
Am meisten über das Aufwachsen, über das Leben der Generationen vor ihm in seiner Familie, über die Gegenwart der Vergangenheit also, denkt er aber in „Zuhause“ nach.
Er, der selbst auch länger eine Psychoanalyse gemacht hat, zitiert in „Zuhause“ irgendwann William Faulkner, der sagte: „Das Vergangene ist niemals tot, es ist noch nicht einmal vergangen.“ Und dann berichtet er von seiner Unfähigkeit, einen Ort zu finden, an dem er einfach bleiben kann und will, er erzählt von seiner Urgroßmutter Wilhelmine, geboren 1880, die mehrfach fliehen musste von dort, wo sie zuhause gewesen war – und die dann nie mehr wirklich sesshaft wurde. Genau so ging es ihm auch. Er war einfach nicht sesshaft, wünschte sich aber nichts sehnlicher, als sesshaft zu werden.
Er schreibt in „Zuhause“ über den „Sog des Vergangenen“, den zu verstehen vielleicht niemandem vergönnt sei. Er schreibt darüber, dass, wenn man jung ist, man glaubt, dazu imstande zu sein, „sich unabhängig von seinen Ursprüngen und seiner Herkunft neu zu erschaffen, durch die Gesellschaft anderer Menschen, den eigenen Willen“. Was aber natürlich nicht möglich ist. „Die Geister der Vergangenheit holen einen in der Regel erst später im Leben ein.“
Und natürlich kann man dann, das ist ja auch das Gemeine, nie die eine Befindlichkeit heute genau auf das eine Ereignis früher zurückführen. Das wäre dann doch zu einfach.
Mit am schönsten (aber gleichzeitig auch ein bisschen rätselhaft) finde ich eigentlich, was er schreibt über den Anfang und das Ende unserer Geschichten, nämlich: „Die Geschichten, die wir über uns und unser Leben erzählen, haben alle keinen Anfang und kein Ende, sie reichen viel weiter in die eigene Biographie hinein, als man es sich vorstellen kann. Bei genauerer Betrachtung stellt sich häufig heraus, dass man gar nicht selbst derjenige ist, der die Anfänge und die Enden wählt, sondern dass man umgekehrt von ihnen gewählt wird. Dass man gar nicht so viel Einfluss darauf hat, welche Geschichten man sich selbst und anderen über sich erzählt.“
Daniel Schreiber schreibt in „Zuhause“ und in „Allein“ und, wie zu vermuten ist, auch in „Zeit der Verluste“ auf sehr berührende, da um Aufrichtigkeit bemühte Art über sich selbst. Die eigenen Erfahrungen bettet er ein in das, was Soziologen / Psychologen / andere Schriftsteller zum jeweiligen Thema erforscht / geschrieben haben. Er schreibt, wie man es sonst eigentlich gewohnt ist, dass Franzosen schreiben. „Zuhause“ und „Allein“ sind zwei sehr lesenswerte Bücher, und vermutlich ist es „Zeit der Verluste“, das ich nicht kenne, auch.